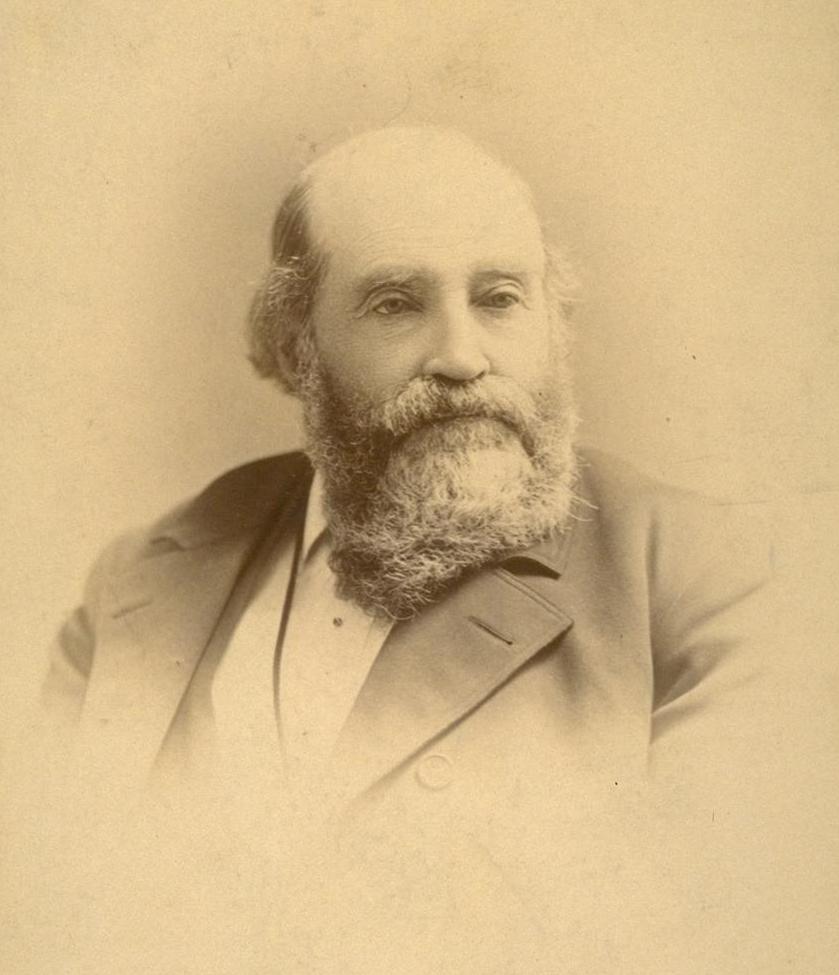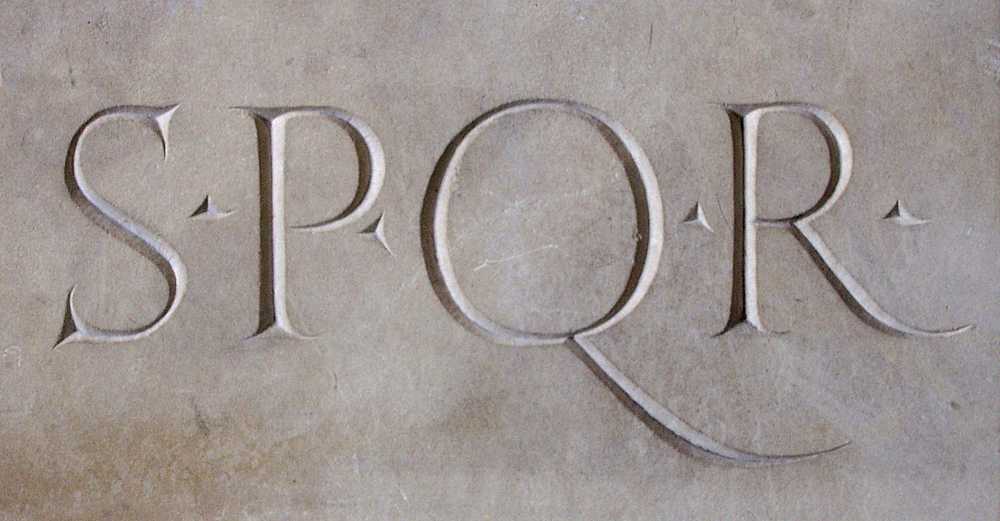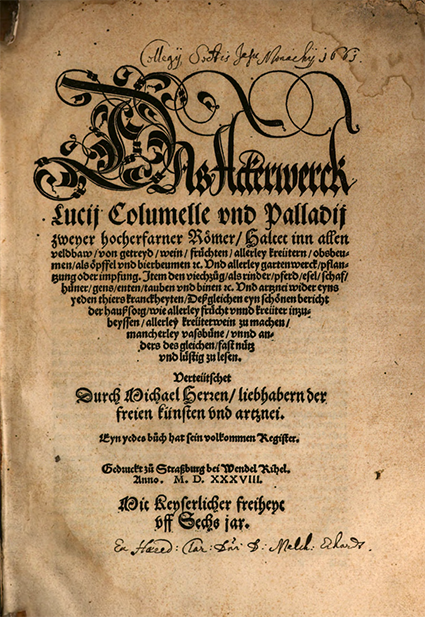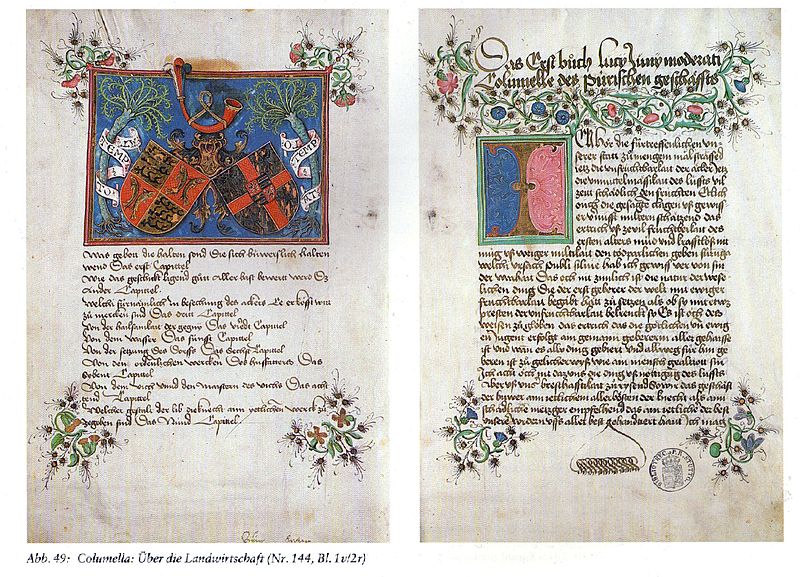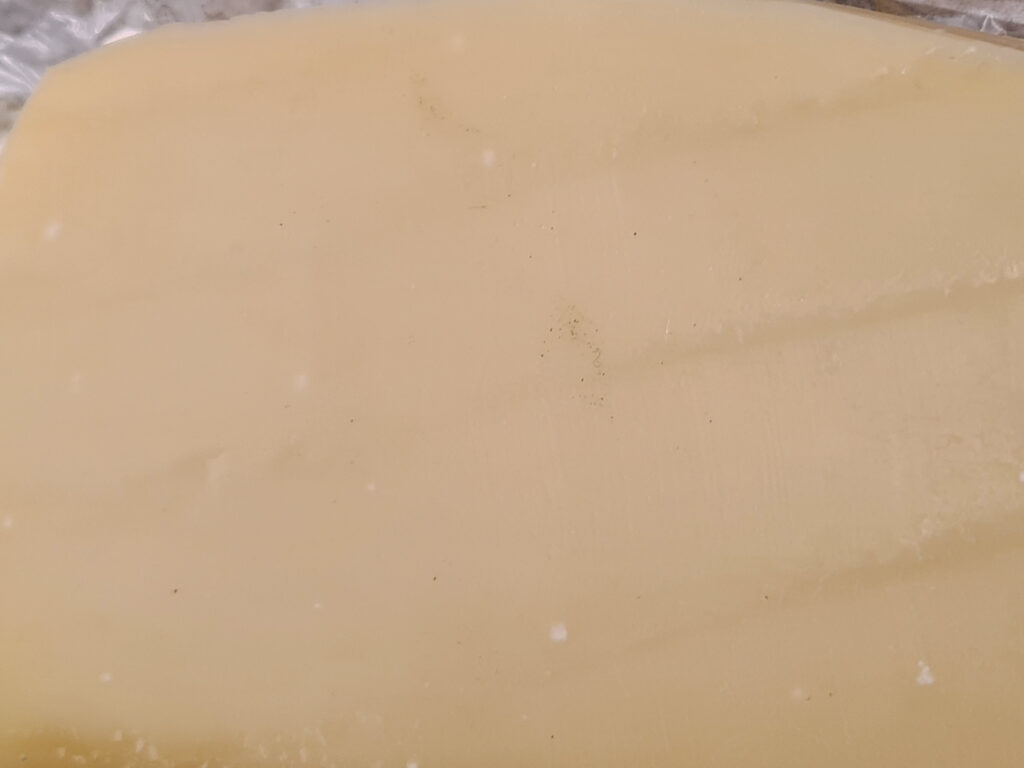Der Monterey Jack, manchmal auch Sonoma Jack oder auch einfach nur Jack genannt, ist vor allem im Westen der USA beliebt, ist aber auch sonst im ganzen Land und zum Teil auch in Europa erhältlich. Der Name geht auf David Jacks aus dem Monterey County in Kalifornien zurück, der um 1890 begann, Käse in der Tradition der dort ansässigen Franziskaner herzustellen und zu vermarkten.
Monterey Jack ist ein halbfester Schnittkäse aus Kuhmilch und einer der wenigen US-amerikanischen Käse, der mit Fug und Recht von sich behaupten kann, in den USA erfunden worden zu sein. Der Monterey Jack wird in den USA, wie in der Schweiz der Mutschli oder in Italien der Carciotta, gerne in der heimischen Küche zubereitet. Wie sein italienischer Bruder der Caciotta, werden häufig verschiedene Gewürze, wie Grüne Pfefferkörner oder Jalapeños dem Teig beigesetzt. Diese werden unter dem Sammelnamen Pepper Jack vermarktet.
Der milde Monterey Jack findet vor allem in der spanisch-mexikanischen und der Tex-Mex-Küche Verwendung zum Beispiel zum Füllen von Tortillas. Er hat gute Schmelzeigenschaften und eignet sich daher auch zum Überbacken und sogar als Bestandteil eines milden Fondues.
Bedeutend würziger, härter und schnittfester ist der Mezzo Secco. Seine Rinde ist meist dunkel rötlichbraun, der schon leicht krümelige Teig blassgelb. Er wird mehrere Male mit einer Mischung aus Pflanzenöl, Salz, Pfeffer und Kakao eingerieben und lagert stehend in gut belüfteten Holzregalen für mindestens 6 Monate.
Der Dry Jack ist ein nicht zu salziger Hartkäse von brüchig-krümeliger, parmesanartiger Textur. Seine Behandlung gleicht der des Mezzo Secco, doch lagert er zumindest 12 Monate. Lange gelagerte trockene Jacks sind von orangegelber Farbe, etwas jüngere zitronengelb. Seine Produktion wurde durch den Importausfall von Parmesan in die USA während des Ersten Weltkrieges initiiert. Er wird vor allem als Hobel- oder Reibkäse zum Verfeinern von Pasta oder Risotto verwendet.
Das Besondere am Monterey Jack ist. Dass nach der Dicklegung und dem Schneiden der Dickete, ein Teil der entstandenen Molke (mindestens 50%) abgelassen und durch kaltes Wasser ersetzt wird. Damit wird ein Teil der Lactose aus dem Käsebruch ausgewaschen, die im späteren Reifungsprozess in Säure umgewandelt worden wäre. Monterey Jack schmeckt daher kaum säuerlich und sogar eher leicht süßlich. Gleichzeitig wird durch das Abwaschen des Käsebruchs mit kaltem Wasser der Feuchtigkeitsgehalt in der Dickete erhöht und der fertige Käse wird weicher und elastischer.
Monterey Jack reift als Young Jack etwa fünf bis sechs Wochen. Als Dry Jack reift der Käse sechs Monate und länger.
Rezept für den Monterey Jack
Zutaten
- 5 Liter Rohmilch
- 250 ml Sahne.
- 90 ml Kefir
- Distellab
- Salz
- Wahlweise: Fein gewürfelte Gartenkräuter oder Meerrettich oder Habanero-Chili oder Pfefferkörner, Jalapeno-Chili etc.
Zubereitung:
- Milch, Sahne und Kefir in den Käsekessel geben, gut umrühren und oder auf 32 °C erhitzen.
- Die Milch ca. 45 Minuten reifen lassen.
- Das Distellab mit etwa 80 ml Wasser vermischen.
- Salz-Lab-Lösung vorsichtig in die Milch einrühren.
- Die Milch zugedeckt bei 32 °C ca. 60 Minuten lang ruhen lassen, bis sich ein fester Käsebruch gebildet hat.
- Den Käsebruch in ca. 1 cm große Würfel schneiden und 10 Minuten ruhen lassen.
- Den Käsebruch nun langsam auf 38 °C erhitzen. Dies sollte sehr langsam geschehen. Den Käsebruch während dieser Zeit vorsichtig, aber häufig umrühren, damit die Bruchstücke nicht zusammenkleben.
- Den Käsebruch für weitere 30 Minuten bei 38 °C halten und dabei weiter rühren, damit der Bruch nicht verklumpt.
- Den Bruch nun ca. 5 Minuten lang nicht umrühren, damit er sich absetzen und die Molke aufsteigen kann.
- Wenn sich der Käsebruch unter der Molke absetzt hat, 50 % der Molke (oder bis knapp über den Käsebruch) abschöpfen oder abgießen. Durch das Entfernen der Molke wird die Aktivität der Bakterien verlangsamt, da ihnen ein großer Teil ihrer Nahrungsquelle (die Laktose in der Molke) entzogen wird.
- Der nächste Schritt ist spezifisch für den Jack-Käse und beinhaltet das Waschen des Bruchs mit kaltem Wasser. Dies führt zu einem höheren Feuchtigkeitsgehalt des Bruchs, da das kühle Wasser beginnt, in den Bruch einzuziehen. Gleichzeitig wird der Käse gekühlt und die Aktivität der Bakterien durch die abkühlende Käsemasse weiter reduziert.
- Dazu die Menge der abgenommenen Molke durch ca. 16 °C warmes Wasser ersetzen
- So viel von dem 16 °C warmen Wasser hinzugeben, dass der Käsebruch auf ca. 30 °C abkühlt, und ca. 15 Minuten weiter rühren.
- Den Käsebruch nun 30 Minuten lang fest werden lassen und dabei alle 5 Minuten umrühren, um ein verkleben zu verhindern.
- Den Käsebruch und die Molke in ein mit einem Käsetuch ausgelegtes Sieb gießen und die restliche Molke abtropfen lassen.
- 10 Gramm Salz und wahlweise Gartenkräuter, Pfefferkörner, Jalapenos usw. über den Käsebruch streuen und mit den Händen vorsichtig vermischen. Dabei eventuell gebildete größere Klumpen aufbrechen.
- Den Käsebruch in eine mit Käsetuch ausgekleidete Form geben und etwa 15 Minuten lang leicht pressen.
- Den Käse aus der Presse und dem Käsetuch nehmen, den Käse wenden, wieder einsetzen und für etwa 12 Stunden mit 4 – 5 kg pressen.
- Den Käse aus der Presse und dem Käsetuch nehmen, die Außenseite des Käses leicht mit Salzlake (15 Gramm Salz in 100 ml Wasser) abwaschen.
- Den Käse auf eine Trockenmatte legen und 1-3 Tage bei Raumtemperatur an der Luft trocknen lassen, dabei jeden Tag zweimal wenden.
- Der Käse kann, wenn sich eine gelbliche Rinde zu bilden beginnt und er sich trocken anfühlt, gewachst oder geölt werden oder Man reibt ihn mit dem Coating für Mezzo Secco oder Dry Jack ein.
- Den gewachsten Käse 1 – 4 Monate lang bei 13 °C reifen lassen. Dabei den Käse im ersten Monat täglich und danach 2 – 3 mal pro Woche wenden, um eine gleichmäßige Reifung zu gewährleisten.
Coating für den Mezzo Secco & Dry Jack
Zutaten:
- 1 Esslöffel dunkle Espressobohnen
- 2 Esslöffel Kakaonibs (roh, ungesüßt)
- 1,5 Teelöffel schwarzer Pfeffer
- 5 Esslöffel Olivenöl
- 1 Teelöffel Lauchasche
Der Käse wurde zuvor einige Tage im Reiferaum getrocknet und von eventuell vorhandenem Oberflächenschimmel befreit.
Die Kakaonibs, die Espressobohnen und der schwarze Pfeffer, müssen alle fein gemahlen werden, bevor sie dem Öl zugesetzt werden. Die gemahlenen Zutaten und die Asche zu einer möglichst glatten Paste verarbeiten und vor der Anwendung einen Tag durchziehen lassen. Die Paste muss sehr gut vermischt werden, und es kann sein, dass mehr Öl benötigt wird, da die Zutaten das Öl aufsaugen.
Für das Coating empfehle ich unbedingt Gummi- oder Latexhandschuhe anzuziehen. Die zuvor zubereitete Paste wird nun auf der gesamten Oberfläche des Käses verreiben, auch in alle Ritzen und Spalten.
Am besten reibt man zuerst nur eine Seite und die Seite ein und wartet etwa einen Tag, bevor man ihn wendet und die andere Seite einreibt.
Nun 2 – 3 Tage warten und erneut das Coating auftragen. Es sollte ausreichen, das Coating 2 – 3 mal aufzutragen, um die Oberfläche zu versiegeln. Sollte die Oberfläche nach einiger Zeit austrocknen, kann man sie mit ein wenig Öl einreiben. Das Öl verhindert, dass sich Schimmel an der Oberfläche festsetzt.
Die Reifung sollte dann bei 11 – 13 °C und 80 – 85% Luftfeuchtigkeit erfolgen, wobei auftretender Oberflächenschimmel beim Wenden abgewischt wird. Die Reifezeit sollte nun mindestens 6 – 9 Monate betragen, aber besser ist es, wenn der Käse ein Jahr und länger reift.