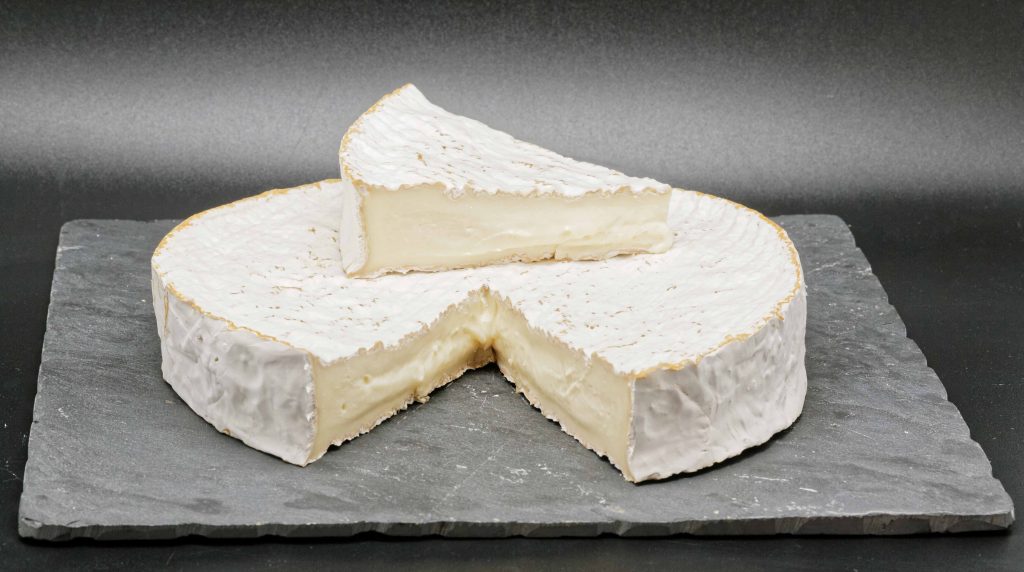Die Gerinnungskraft von pflanzlichem Labenzym schwankt. Sie hängt von vielfältigen Faktoren ab, wie Wachstumsbedingungen, Entwicklungsstadium der Pflanze, Alter der Pflanzenteile, Trocknungs- und Lagerbedingungen, der Art des eventuell verwendeten Extraktionsmittel u.v.m.
„Columella“, ein römischer Großgrundbesitzer, hat in seinem „re rustica“, einem Lehrbuch der Landwirtschaft, umfangreiche technologische Angaben zur Herstellung von Käse niedergelegt. Er empfiehlt zum Beispiel als Labersatz die Blüten wild wachsender Disteln oder den Saft des Feigenbaumes (eignet sich nur für Frischkäse). Hier werden Begriffe genannt, von denen sich die heutigen Bezeichnungen für Käse ableiten. Aus Kalathos (griechisch) = Korb beziehungsweise Caseus (latein) = Korb wurden „Käse, Cheese, Queso, Kaas“. Das französische „Fromage“ kommt von „forma“, der Form für die Käsebereitung.
Es gibt verschiedene Rezepturen für die Herstellung von Distellab.
Hier eine kleine Sammlung:
1. Die Methode wie man in Italien Lab aus Wilddisteln herstellt,
von Vincenzo G.
„Ich erntet perfekt reife und aufgeblühte Wilddisteln (tiefviolett oder fuchsiafarben, je nach Distelart). Dann schneide ich sie mit ca. 20-25 cm Stiel ab und bilde Sträuße (mit je 4-5 Disteln), die ich am Ende mit einer Schnur festbinde und dann kopfüber an einem kühlen Ort (Keller bei einer Temperatur von 17-18 °C) und vor Licht geschützt kopfüber aufhänge. In lasse sie 20 Tage lang trocknen. Danach gehe ich mit aller notwendigen Sorgfalt vor, um „Stiche“ von den Dornen der Distel zu vermeiden, und beginne die Staubgefäße und die Stempel mit viel Feingefühl herauszuziehen, sie dürfen dabei nicht brechen. Dann legte ich die extrahierten Staubgefäße und Stempel in mäßig warmes Wasser (42 °C), wobei sie alle vom Wasser bedeckt sein müssen. Dann deckte ich die Schale mit einem Teller ab, um sie vor Licht zu schützen, und lasse sie so für 24 Stunden stehen. Das Wasser, das ich verwendet habe, war natürliches Mineralwasser (nicht aus der Leitung) im Verhältnis 1 zu 10 (40 g Staubgefäße und Stempel eingetaucht in 400 ml Wasser). Nach 24 Stunden nehme ich die Staubgefäße und die Stempel aus der Schale und pressen sie mit den Händen, damit sie die aufgesaugte Flüssigkeit abgeben. Mit Hilfe eines zuvor mit warmem Wasser gewaschen und dann getrockneten Seihtuchs wird die Flüssigkeit dann zweimal gefiltert, um so jede Art von Verunreinigung zu beseitigen. Der pH-Wert lag bei 5,9 (ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das der richtige pH-Wert für pflanzliches Lab ist). Zum Schluss wird die Mischung in eine Plastikflasche umgefüllt und bei 6 °C in den Kühlschrank gestellt.
Dann nahm ich einen halben Liter Milch, um zu testen, ob das Lab die Milch tatsächlich gerinnen lässt. Es dauerte 90 Minuten, aber schließlich gerann die Milch. Ich erhitzte sie auf 40 Grad und gab 2,5 ml Lab hinzu (500 ml pro 100 Liter Milch).
Der Käsebruch war sehr zart, aber das erwartete ich, weil ich hier und da gelesen habe, dass die Verwendung von Distellab zu einem Käsebruch führt, der länger dauert als ein herkömmlicher, weniger ergiebig ist, sehr zerbrechlich und weich ist und einen leicht bitteren Geschmack hat. Ich habe es tatsächlich probiert, sehr präsenter zartbitterer Geschmack, aber nicht lästig.
Nach verschiedenen Tests kann ich mit Sicherheit sagen, dass das ideale Verhältnis von Verdünnung und Aufguss von Staubgefäßen und Stempeln 1/4, 1/5 beträgt, um ein Lab mit einem pH-Wert von 5,2/5,3 und einer Gerinnungsfähigkeit von 1:15000/1:2000 zu erhalten.
Kommerzielles pflanzliches Lab wird auf die gleiche Weise hergestellt, aber im Labor wird Ammoniumsulfat hinzugefügt. Ammoniumsulfat wird als Düngemittel in der Landwirtschaft, aber auch für Lebensmittel (E 517) verwendet und entsteht durch eine chemische Reaktion zwischen Ammoniak und Schwefelsäure.
Natürlich gibt es auch eine direkte Methode, um Milch mit Distelblüten gerinnen zu lassen. Diese Methode ist in Spanien und Portugal weit verbreitet. Dazu nimmt man die Staubgefäße und Stempel der Distel (wenn sie schön reif ist und leuchtend fuchsiafarben sind), wickelt sie in ein Tuch und legt das Bündel in die Milch, wobei man sie mindestens eine Minute lang umrührt. Die heiße Milch zieht die gerinnenden Enzyme an und die Milch gerinnt nach 40-60 Minuten.
Bedenken Sie, dass Distellab, insbesondere wenn es selbst hergestellt wird, äußerst akzeptabel ist. Er verleiht dem Käse eine deutlich erdige Note von Unterholz, Stroh, Pilzen und Gras. Eine unverwechselbare Facette.
Distellab sollte in größeren Mengen verwendet werden als normales Lab oder gekauftes Distellab. Seien Sie aber vorsichtig, denn es hat eine hohe proteolytische Kraft. (Als Proteolyse bezeichnet man die enzymatische Hydrolyse von Proteinen durch Peptidasen, also den Abbau von Proteinen. Von Autoproteolyse spricht man, wenn sich eine Peptidase selbst abbaut. Die Proteolyse kann durch Proteaseinhibitoren gehemmt werden. Ein Proteinhydrolysat ist ein Produkt einer Proteolyse.)
2. Anleitung aus Brasilien
Auf einer Seite aus Brasilien findet sich eine Anleitung zur eigenen Cardo-Käse-Herstellung, die hier auf deutsch zusammengefasst ist:
Im Herbst werden die Röhrenblüten der stacheligen Cardo geerntet und im Schatten zum Trocknen ausgelegt. Die Cardo-Blüten halten sich lange. Mit der Zeit verliert das in ihnen enthaltene Enzym jedoch an Kraft, so dass man bei alten Vorräten etwas mehr Cardo verwenden muss.
Will man einen Käse machen, setzt man zuerst eine Infusion bzw. einen Aufguss aus Salz (20 – 35 Gramm pro Liter Milch) und getrockneter Cardoblüte (1 – 2,5 Gramm pro Liter Milch) auf. Wenn der Cardo gezogen hat, wird die bereits pasteurisierte Milch auf Körpertemperatur erwärmt (35 – 40 °C). Bevor man den fertigen Aufguss der Milch zufügt, muss auch dieser auf 28 – 30 °C erwärmt werden.
3. Anleitung aus Italien von Gianfranco
Für das Distellab sammelt er im Frühsommer die voll aufgeblühten Blüten wilder Disteln, Cynara cardunculus, hängt sie umgekehrt zum Trocknen auf und weicht die violetten Blütenblätter in lauwarmem Wasser ein. Zwanzig Blüten sind nötig, um hundert Liter Milch dickzulegen – auf diese Idee kommt man nur in einer Landschaft, die von Disteln förmlich bestimmt wird.
Gianfranco sagt, mit Distellab laufe vergleichsweise weniger Molke aus dem frischen Käse ab, sodass sein Käse etwas feuchter und säuerlicher ist.
4. Distellab aus der Kratzdistel (Cirsium vulgare)
Dieses Rezept verwendet die Gewöhnliche Kratzdistel (cirsium vulgare), eine violette Distel, die an vielen Orten als Unkraut wächst.
Entfernen Sie den Blütenkopf der Distel, nachdem er an der Pflanze ein wenig gebräunt ist. Pflücken Sie den Kopf, bevor er beginnt, Distelflaum zu produzieren. Nehmen Sie die Blüten mit und trocknen Sie diese an einem sonnigen, belüfteten Ort. Sobald die Blütenköpfe vollständig getrocknet ist, pflücken Sie die Staubgefäße oder die purpurnen Fäden von dem Kopf ab. Geben Sie die geernteten Staubgefäße in ein sauberes, trockenes Glas mit luftdichtem Deckel.
Was Sie brauchen:
5 Esslöffel gemahlene Kratzdistel (Cirsium vulgare)
1 Schüssel warmes Wasser
1 Plastiksieb
Zerkleinern Sie die getrockneten Staubgefäße der Distel in einem Mörser. Mahlen Sie so viel, dass Sie 5 Esslöffel Pulver erhalten.
Legen Sie die getrockneten und gemahlenen Staubgefäße in eine kleine Schüssel. Geben Sie warmes Wasser (nicht heiß, um die gerinnungsfördernden Enzyme nicht abzutöten) in die Schüssel und lassen Sie das Gemisch 10 Minuten ziehen. Das Wasser wird eine braune, trübe Farbe annehmen, wenn es fertig ist.
Seihen Sie die Flüssigkeit ab. Diese Flüssigkeit ist das Distellab zur Verwendung bei der Käseherstellung. Verwenden Sie diese Flüssigkeit anstelle von tierischem Lab in der Menge von 240 ml Distellab pro ca. 4 Liter erwärmter Milch.
Wenn Sie es nicht sofort verwenden können, bewahren Sie das Distellab in einem fest verschlossenen Glas im Kühlschrank auf. Um beste Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie es so schnell wie möglich verwenden. Wenn Sie das Lab nicht sofort verwenden, lagern Sie die Distelstempel besser getrocknet in einem luftdicht verschlossenen Glas im Kühlschrank.
5. Rezeptur aus dem Buch: Die Kunst der natürlichen Käseherstellung von David Asher
Die bekannteste Pflanze mit milchgerinnenden Eigenschaften ist die wilde Artischocke mit dem botanischen Namen Cynara cardunculus. Sie ist eine nahe Verwandte der Kugelartischocke und wird kommerziell wegen ihrer fleischigen Stängel angebaut, die in der Mittelmeerküche gerne verwendet werden. Ebenfalls dient sie oft als Zierde wegen ihrer auffälligen Blüten mit borstigen Dornen und einem Schopf aus kräftig blauen Blütenblättern. Aus den getrockneten Blütenblättern der wilden Artischocke erhält man ein milchgerinnendes Enzym, das bei einigen traditionellen portugiesischen und spanischen Schafs- und Ziegenkäsen wie dem Torta del Casar verarbeitet wird. Ein Absud aus den getrockneten Blütenblättern, der in die Milch gegossen wird, kann die Milch zu einem halbfesten Bruch gerinnen lassen.
Dafür lassen Sie zwei Gramm getrocknete Artischockenblütenblätter für eine Stunde in 60 ml warmem Wasser ziehen. Seihen Sie die Flüssigkeit ab, drücken Sie den Saft aus den Blütenblättern und gießen Sie den Labersatz in etwa vier Liter warme gesäuerte Milch, genau so, als würden Sie Kälberlab verwenden. Die bucklige Monferrato-Distel (Cardo gobbo di Nizza Monferrato) kann auch zu Distellab verarbeitet werden.
6. Distelab mit Salz
Die Blütenblätter der Cynara cardunculus (Familie Asteraceae, Gattung Artischocken), eine Distel- Artischocke, werden bei der Produktion des portugiesischen D.O.P.-Käses Queijo Serra da Estrela (Queijo da Serra) eingesetzt. Dabei werden entweder die getrockneten Blütenblätter mit Salz zerstampft, angefeuchtet und in ein Tuch gegeben, das dann zum Durchseihen der Käsereimilch dient. Oder es wird ein Extrakt aus den Blütenblättern gewonnen, welcher der Käsereimilch zugegeben wird.
Auch wird aus einem Aufguss aus den Staubblättern von Cynara cardunculus die rohe Schafsmilch dickgelegt.
7. Ein weiteres Distellab Rezept
Der Teil der Karde, der zur Gerinnung von Milch für die Käseherstellung verwendet wird, sind die lavendelfarbenen Staubgefäße, die während der Blütezeit der Pflanze erscheinen. Die Staubgefäße können abgezupft oder mit einem Messer von der Basis abgeschnitten werden. Die Staubgefäße sollten bei Raumtemperatur etwa 3 Wochen lang getrocknet werden, Ich hänge sie dazu kopfüber im Heizungskeller auf. Die getrockneten Staubgefäße sind bis zu 2 Jahre haltbar.
In einem Mörser oder einem Mixer mahlen Sie die Staubgefäße zu einem Pulver. Die empfohlene Verwendungsmenge ist 1 Gramm getrocknete Blüten pro Liter Milch. Die gemahlenen Staubgefäße werden in Wasser bei Zimmertemperatur in einem Verhältnis von 1 Gramm Staubgefäße auf 10 ml Wasser eingeweicht. Lassen Sie die Mischung 30 Minuten ziehen. Vor der Verwendung durch einen Papierfilter abseihen. Der gereiften Milch bei 30 °C hinzufügen, d. h. 100 ml Lösung auf 10 Liter Milch. Die Gerinnung sollte innerhalb von 30 bis 45 Minuten erfolgen. Es können auch frische Blüten verwendet werden, wobei der Verbrauch leicht reduziert werden kann, da die Aktivität in frischem Zustand stärker ist. Dieses Gerinnungsmittel ist stärker proteolytisch und führt zu einem weicheren Käse, der wie gewünscht hergestellt werden kann.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Labenzymen, die nur die Enden der Milchkasinproteine abschneiden, spaltet Distellab die Kasinproteine an vielen Stellen. Bei Kuhmilch kann dies zu einem leicht bitteren Geschmack führen, jedoch nicht aber bei Ziegen- oder Schafsmilch. Ich selbst habe nie einen bitteren Geschmack feststellen können. Der bittere Geschmack tritt abe rnur bei Überdosierung des Distellab oder bei falscher Herstellung desselben auf.
Ich zerkleinerte die Staubgefäße mit einem Stößel und Mörser und mischte sie mit 70 ml abgekochtem und abgekühltem Wasser. Das Wasser muss warm, aber nicht zu heiß sein. Wenn das Wasser zu heiß ist, tötet es das Enzym in der Pflanze ab, das den Käsebruch binden soll. Ich ließ die Mischung 30 Minuten ziehen, während meine Milch kultiviert wurde, dann filterte ich sie durch einen Kaffeefilter und verwendete sie wie normales Lab.
8. Mariendistel (Silybum marianum)
Mariendistel eignet sich auch zum dicklegen der Milch. Das Wichtigste ist, dass es voll erblüht und ausgereift ist.
9. Rezept aus dem Montefeltro und den Marken
Die Narben der Blüten werden in etwas warmes Wasser eingerieben und eingeweicht. Die gesamte Mischung wird in frisch gemolkene, bereits erwärmte Milch gefiltert, die mit langsamen, regelmäßigen Bewegungen gewendet. Die Milch wird etwa 40 Minuten lang ruhen gelassen. Nachdem der Käsebruch in sehr kleine Partikel zerkleinert wurde, lässt man ihn einige Minuten ruhen, damit sich der Käsebruch am Boden des Behälters absetzen kann. Danach wird die Masse in die traditionellen Formen, die „Fascere“ gelegt und mit den Handflächen gepresst, um das Abfließen der Molke zu erleichtern. Das Trockensalzen erfolgt, indem die Käse in Salz eingelegt und alle 12 Stunden bis zu maximal 2 Tagen gewendet werden. Die Reifung dauert zwischen 2 und 6 Monaten.
Anmerkung:
„Frischer Distelextrakt besteht hauptsächlich aus einem komplexen Proteinasesystem. Proteinasen sind Enzyme, die Proteine spalten. Dabei lösen sie Peptidbindungen zwischen einzelnen Aminosäuren durch Hydrolyse.
Proteinasen sind in der Distelpflanze, insbesondere in den Stempeln, wahrscheinlich in Form von Zymogenen vorhanden, so dass die Gerinnungsaktivität des Extrakts mit der Zeit nach der Extraktion zunimmt.
Zymogene oder Proenzyme sind inaktive Enzymvorstufen. Im Gegensatz zu Apoenzymen werden sie durch Proteasen (Proteolyse) oder das Enzym selbst (Autoproteolyse) in die aktive Form überführt.
Aktive Distelextrakte weisen nur zwei Proteinasen auf, obwohl kürzlich ein Verfahren entwickelt wurde, bei dem der Distelrohextrakt mit (NH₄)₂SO₄ (Ammoniumsulfat – E 517) in unterschiedlichen Mengen behandelt wird, um die Rückgewinnung von drei Proteinasen zu ermöglichen, wodurch die Gerinnungsfähigkeit des Labs erhöht und gleichzeitig seine proteolytische Aktivität verringert wird.“
Hinweise:
Das in Deutschland bei Käsereibedarf Leidinger angebotene Distellab enthält ebenfalls Salz.
Einige Informationen besagen, dass es bis zu eine Nacht dauern kann bis die Milch dickgelegt ist, wenn die verwendeten Disteln alt waren? Bei der Verwendung von pflanzlichem Lab kann es also bis zu 24 Stunden dauern, bis der Käsebruch fest wird.