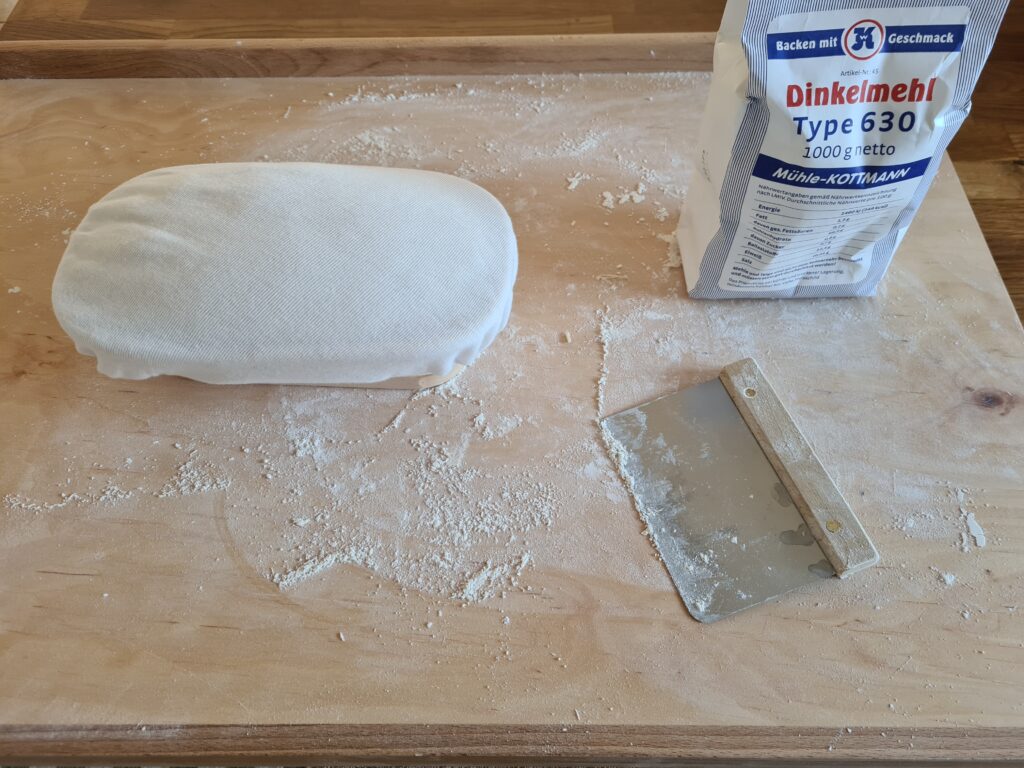Wer es wirklich traditionell machen will, züchtet sich seine Wildhefe als Ersatz für industriell hergestellte Hefe selbst, indem er Hefewasser (Fermentwasser) herstellt.
Stellt man sein Hefewasser selbst her, weiß man was drin ist, anders als bei gebleichter, industriell hergestellter Hefe aus dem Kühlregal im Supermarkt.
Hefewasser ist verträglicher als Industriehefe. Es gibt Menschen die von Industriehefe in Backwaren einen Blähbauch bekommen, das geschieht bei der Verwendung von Hefewasser nicht. Auch der Geschmack ist anders. Der deutliche Hefegeschmack und Geruch, der bei der Verwendung von Industriehefe auftritt fehlt hier. Der Geschmack ist etwas fruchtiger und süßlicher ohne dabei aufdringlich zu sein.
Die Herstellung von Hefewasser ist kinderleicht!
Zutaten:
500 ml Wasser, handwarm
100 g Trockenfrüchte (ungeschwefelt, nicht geölt.
50 g Honig
Es eignen sich getrocknete, Datteln, Rosinen, Feigen, Äpfel, Apfelschalen, Tomaten etc. für den Ansatz. Auch ungemahlenes Getreide kann man verwenden. Auf all diesen Trockenfrüchten leben Wildhefen die sich für die Herstellung von Hefewasser eignen. Jedoch müssen es Trockenfrüchte in unbehandelter Bio-Qualität sein und sie dürfen auf keinen Fall geschwefelt oder geölt sein!


Weiterhin sollte eine etwa 1 Liter fassendes Weckglas bereitstehen. Wenn das Glas einen Gärstopfen hat wäre das noch besser. Sonst wird es mit einem Tuch abgedeckt.
Das Wasser, den Honig und die Trockenfrüchte in das Glas geben und gut verrühren, bis sich der Honig völlig aufgelöst hat.
Das Glas mit einem Tuch oder mit einem Deckel mit Gärstopfen verschließen und bei 25 – 30 °C einen Tag ruhen lassen. Währenddessen zweimal täglich umrühren oder das Glas schütteln, das beugt der Bildung von Schimmel vor.
Wenn die Temperatur nicht unter 20 °C sinkt ist das Hefewasser nach etwa 2 – 5 Tagen fertig.
Das fertige Hefewasser durch ein Sieb gießen um die groben Trübstoffe zu entfernen. Es sollte vom Geruch und vom Geschmack her süßlich, fruchtig und vergoren riechen und vom Geschmack an Federweißer oder Most erinnern. Keinesfalls sollte es noch übermäßig süß schmecken.
Hefewasser wird im Kühlschrank bei 5 °C gelagert und dabei auch immer wieder geschüttelt werden. Man kann es jederzeit nach obiger Methode wieder auffrischen. Einfach wieder Wasser und Trockenfrüchte sowie Honig zugeben und erneut in warmer Umgebung gären lassen. Durch das immerwährende auffüttern reift das Hefewasser nach und entwickelt immer mehr natürliche Hefen wodurch die Triebkraft des Hefewassers gesteigert wird.
Das Hefewasser ist die Grundkomponente zur Herstellung von Lievito Madre. Wenn im Rezept zur Herstellung von Lievito Madre von Wasser die Rede ist, so ist immer Hefewasser gemeint.
Man kann das Hefewasser auch direket zum Backen benutzen. Dann lässt man die im Rezept angegebene Hefe weg und ersetzt die Hälfte der im Rezept angegebenen Flüssigkeit durch Hefewasser. Die Gehzeiten können sich dabei verändern.
Wieviel Wilde Hefe?
Die Faustformel lautet: 100-125 ml Hefewasser für 500 g Mehl, Das entspricht in etwa einem Päckchen Trockenhefe bzw. ½ Würfel Frischgefe. Frisch angesetztes Hefewaser hat noch nicht viel Triebkraft, die Wildhefe sollte noch etwas reifen und sich vermehren können. Das Hefewasser sollte vor der Entnahme im Glas kurz aufgeschüttelt werden, da sich die Hefe am Boden des Gefäßes absetzt. Bei frisch angesetztem Hefewasser empfiehlt es sich daher, die doppelte Menge, also 200-250 ml auf 500 g Mehl zu verwenden. Selbstverständlich muss die im Rezept angegebene Flüssigkeitsmenge um die entsprechende Flüssigkeitsmenge des Hefewassers reduziert werden.
Wilde Hefe oder Backhefe?
Brot das mit Wildhefe, also Hefewasser hergestellt wird, braucht oft mehr Zeit zum Gehen (20 – 24 Stunden), dafür bleibt es aber länger frisch. Eine eine längere „Stehzeit“ sorgt dafür, dass die Bekömmlichkeit erhöht wird, denn einige unerwünschte Stoffe werden dabei abgebaut und die Verfügbarkeit anderer Stoffe (z.B. Magnesium und Kalzium) für den Körper wird verbessert.
Backhefe besitzt eine hohe Triebkraft und sorgt für feinen Geschmack bei Backwaren. Einige spezielle Sorten sind daraufhin gezüchtet, bei besonderen Hefeteigen für ausreichend Triebkraft zu sorgen. Backhefen zeichnen sich durch hohe Triebkraft und ein geringes Maß an Gluten-zerstörenden Enzymen aus. Gleichzeitig sorgen sie für feinen Geschmack bei Backwaren. Durch die Weiterzüchtung ist die Bäckerhefe triebstärker als die wilden Hefen im Sauerteig, sie verträgt aber im Gegensatz zur Sauerteighefe viele andere Stoffe nicht: Säuren, Salze, Fette und anderes mehr.
Frisches Hefegebäck führt vereinzelt zu Verdauungsbeschwerden wie z.B. Blähbauch, dies kann unterschiedliche Ursachen haben. Wer unter einer Histaminintoleranz leidet, kann unter Umständen auf Hefe empfindlich reagieren. Der Grund ist die enthaltene Glutaminsäure in der Hefe.
Frischhefe & Teigführung
Grundsätzlich sollte man wenig Hefe verwenden und den Teig dafür länger gehen lassen.
In einem handelsüblichen Würfel Frischhefe stecken 42 Gramm Hefe. Somit entspricht eine Packung Trockenhefe der Triebkraft von einem halben Würfel Frischhefe. Die 7 g aus dem Tütchen Trockenhefe entsprechen in etwa 21 g frischer Hefe.
In vielen Rezepten wird die Hefemenge zu hoch angegeben. Dies mag darauf zurück zu führen sein, dass in unserer heutigen Zeit alles schnell gehen muss. Wenn ich keine Zeit habe und schnell ein Brot backen will, ist eine höhere Hefemenge sicher sinnvoll. Jedoch leidet der Geschmack darunter.
Backhefemenge zu Mehlanteil:
| Backprodukt | Mehlanteil |
| Normalbrot | 1 – 3 % |
| Hefesüssteige | 2 – 7 % |
| Tourierte Teige | 5 – 10 % |
Ab 1 Std. Gärdauer sollte man den Teig für den Rest der Zeit in den Kühlschrank geben. Jedoch zuvor immer mindestens 1 Std. Bei Zimmertemperatur angären und dann erst in den Kühlschrank geben.
Als Richtwert kann diese Tebelle dienen:
| Gärdauer in Std. | Hefeanteil auf 1 kg Mehl | nach 1 h in den Kühlschrank |
| 1 – 2 h | 20 – 30 g | |
| 6 – 8 h | 10 – 15 g | X |
| 8 – 12 h | 5 – 10 g | X |
| 12 – 24 h | 1 – 5 g | X |