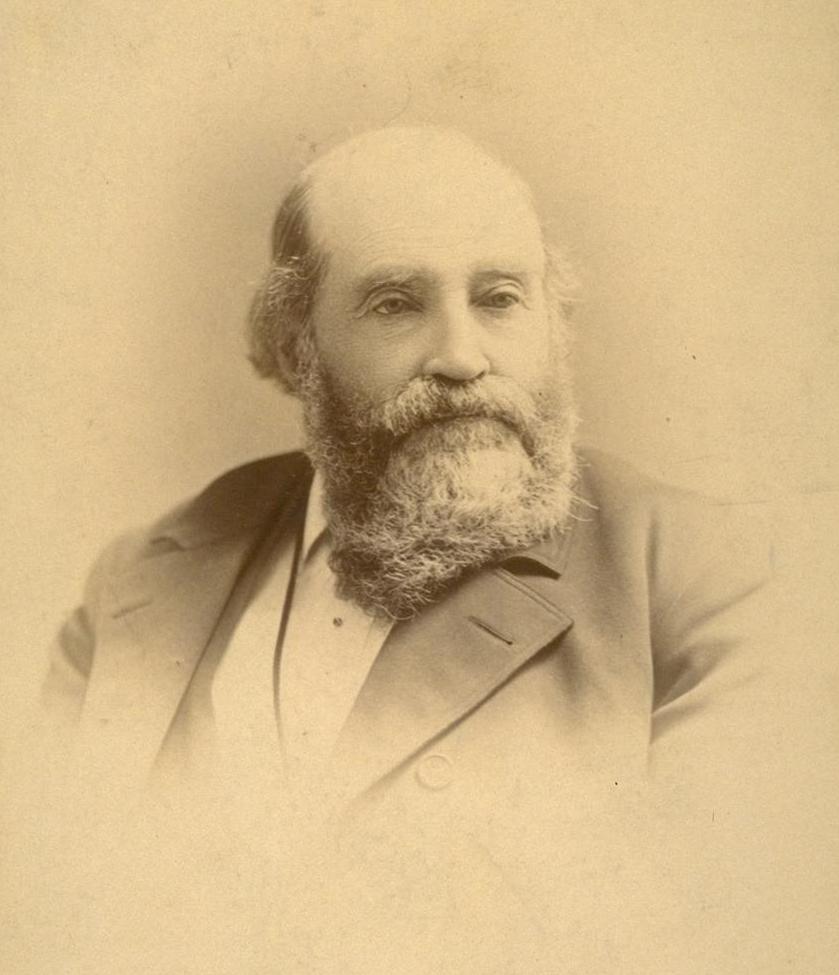Jeder Inhalt ist geformt und jede Form bestimmt einen Inhalt!
Oder wie es schon der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel beschrieb: „Bei dem Gegensatze von Form und Inhalt ist wesentlich festzuhalten, daß der Inhalt nicht formlos ist, sondern ebensowohl die Form in ihm selbst hat, als sie ihm ein Äußerliches ist. „
Es gibt viele verschiedene Arten von Käseformen, einige sind für bestimmte Käsesorten charakteristisch, andere sind allgemein verwendbar. Größe, Form und Entwässerung der Formen wirken sich jeweils auf den fertigen Käse aus. Das Verhältnis von „Höhe zu Breite“ und „Oberfläche zu Masse“ wirkt sich auch auf die Reifung, die Stabilität des Käses bei der Handhabung aus.
So würde beispielsweise ein Käse mit gewaschener Rinde oder ein weich gereifter Käse, der vom Rand zur Mitte hin reift, nicht richtig reifen, wenn er zu dick ist. Ist er jedoch zu breit, wäre er sehr schwer zu handhaben.
Laut Wikipedia versteht man unter dem Begriff «Laib» im Allgemeinen eine runde, teilweise auch ovale oder längliche Form von Brot, anderen Backwaren sowie auch von Käse und verschiedener durch Backen zubereiteter Fleischgerichte.
Ursprünglich bezeichnete „Laib“ das „ungesäuerte Brot“. Ab dem 17. Jahrhundert war es eine Normbezeichnung für die geformte Masse bei Brot und Käse und wurde im Unterschied zum Leib (Körper) mit „ai“ anstelle von „ei“ geschrieben.
Bereits seit den Anfängen der Käseherstellung werden immer runde Käseformen beschrieben. Indikatoren sind auch heute noch, dass die Käseherstellung bis zur Käsepflege mit einem runden Laib einfacher zu handhaben ist. Vom ursprünglichen Auszug des Käsebruches aus der Käsepfanne mit einem Tuch, die Pressung des frischen Käsebruches in der Form, das Verhalten im Salzbad durch ein optimales Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen bis hin zu Vorteilen während der Käsereifung mit der regelmäßigen Schmierung.
Das Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis (A/V-Verhältnis) ist der Quotient aus der Oberfläche „A“ und dem Volumen „V“ eines geometrischen Körpers. Es hat die Dimension „1/Länge“. Das A/V-Verhältnis [m²/m³] beschreibt das Verhältnis von Oberfläche A [m²] zu Volumen V [m³] und gibt somit Auskunft über die Kompaktheit eines Körpers.
Bei gegebenem Volumen weist von allen Körpern die Kugel die kleinste Oberfläche auf. Bei wachsendem Volumen nimmt das A/V-Verhältnis bei allen Körpern ab, da die Oberfläche quadratisch, das Volumen jedoch kubisch (in der dritten Potenz) wächst.
Bei der Käseherstellung bedeutet dies:
Kleiner Käse = mehr Oberfläche, wenig Volumen
Großer Käse = wenig Oberfläche, mehr Volumen
Große Käse mit einem kleinen Oberflächen-Volumen-Verhältnis liegen länger im Salzbad als kleine Käse mit einem großen Oberflächen-Volumen-Verhältnis.
Verständlich wird die Bedeutung des A/V-Verhältnis am Beispiel von Brie und Camembert. Beide Käse werden bis zu dem Punkt, an dem der Bruch in die Formen gegeben wird nahezu identisch hergestellt. Der Brie ist deutlich größer als der Camembert und dies verändert bei beiden das Verhältnis zwischen Oberfläche und Käseinnerem. Dies wiederum wirkt darauf ein, wie diese beiden Käse reifen. Der kleinere Camembert reift für gewöhnlich schneller, etwa ein bis zwei Monate und wird cremiger als der große Brie, weil die Entwicklung des Camemberts von der Oberflächenreifung bestimmt ist. Der Brie reift drei bis vier Monate und entwickeln dabei ein reichhaltigeres Aroma.
Gibt man Kräuter oder Gewürze zum Bruch, kann sich durch das optimale Verhältnis von Oberfläche zu Volumen das Aroma der Kräuter gleichmäßig über den ganzen Laib verteilen.
Bei großen bis sehr großen Käselaiben ist es notwendig, ein Höchstgewicht für den Käse festzulegen, weil das Gewicht durch das Verhältnis Oberfläche zu Volumen auch den Reifungsprozess (und somit die organoleptischen Eigenschaften) beeinflusst. Die Form beeinflusst und steuert so die Reifungsfloren.
Mit der Käseform bestimmt der Käser was für einen Käse er erzeugen will. Daher sollte man sich immer Gedanken über die Form machen und auch immer wieder experimentieren. Eine andere Form kann ein altbekanntes Käserezept völlig auf den Kopf stellen – zum Guten wie zum Schlechten. Die verwendete Käseform hängt zumeist mit dem lokalen Ursprung des Käses zusammen und ist oft über Generationen überliefert.
Außerdem ist eine runde Form besser als eine quadratische, da das Verhältnis von Oberfläche zu Masse geringer ist. Die Ecken von Käse aus quadratischen Formen neigen dazu, schneller auszutrocknen.
Verschiedene Käseformen
Die Ciambella
Dies ist eine einzigartige, „doughnutförmige“ Käseform. Die Form des Doghnut, oder einfach Kringel oder Rettungsring (italienisch „Ciambella“) bietet einige Vorteile. Das Loch in dieser Form sorgt für mehr Oberfläche auf dem Käse, so dass kein Punkt des Käses weit vom Rand entfernt ist. Dies bewirkt, dass der Käse wie ein kleinerer Käse reifen kann. Diese Form eignet sich am besten für oberflächengereiften Käse, der wenig bis gar nicht gepresst werden muss.


Die zusätzliche Oberfläche des fertigen Käses ist ideal für Käse mit gewaschener Rinde, da so mehr Oberfläche gewaschen werden kann und sich ein komplexer Geschmack entwickeln kann.
Diese Form löst auch das Problem, dass der Käse in der Mitte zu wenig und an den Rändern zu stark reift.
Kleine „Ciambella“ lassen sich mit Hilfe modifizierter Sandkastenformen herstellen. Fabrikneue „Gugelhupf- Sandformen“ mit Löchern versehen und man kann hervorragende kleine Weichkäse oder gereifte Frischkäse herstellen.
Ein schönes und gelungenes Beispiel für einen modernen Käse in Krapfenform ist der „Mühlistein“ von Meisterkäser Käser Willi Schmid aus Lichtensteig in Toggenburg, Kanton St. Gallen.
Ein weiteres Beispiel ist der französische Murol, auch Grand Murol oder Murol du Grand Bérioux benannt. Ebenfalls ein Käse aus Kuhmilch, dessen Laib ein Loch in der Mitte ziert.
Die „kleine weibliche Brust“
Eine andere außergewöhnliche Käseform ist die des Queso Tetilla (galicisch Queixo Tetilla), eines traditionellen galicischen halbfesten Kuhmilchkäse mit geschützter Herkunftsbezeichnung.
Der Name bedeutet „kleine weibliche Brust“ und deutet auf sein birnenförmiges Aussehen hin, das er durch die Herstellung im Tropfverfahren erhält. Der Wortstamm ist germanisch und gleich dem der Worte „Titte“ und „Zitze“. In der deutschen Übersetzung wird der Käse gelegentlich auch „Busenkäse“ genannt.
Für Santiago de Compostela gibt eine volkstümliche Überlieferung folgenden Grund für die Entstehung des Tetilla an:
Gegenüber dem Propheten Daniel befindet sich im Glorienportal der Kathedrale von Santiago die Königin Saba. Angeblich gilt sein Lächeln ihrem Dekolleté. Einem Erzbischof soll dieses Dekolleté einst als zu üppig ausgestattet aufgefallen sein, so dass er Steinmetze beauftragte, den Busen abzuflachen. Die empörte Reaktion der Compostelaner Bürger soll die Herstellung des Käses in Busenform gewesen sein.
Ein anderer Käse mit dieser Form ist der San Simón da Costa, ein ebenfalls aus Galizien stammender geräucherter Kuhmilch Schnittkäse. Der San Simón da Costa ist seit dem Jahr 2008 EU-weit mit dem DOP-Label geschützt.
Der San Simón da Costa geht vermutlich auf die im Nordwesten der Iberischen Halbinsel beheimatete eisenzeitliche “Castrokultur” (ca. 1.000 v. Chr. – ca. 100 v. Chr.) zurück. Überlieferungen zufolge wurde der Käse sogar bis in das antike Rom geliefert. Auch sollen und Steuern und Pacht mit dem San Simón da Costa bezahlt worden sein.
Die traditionelle Korbform
Käse aus Korbformen (italienisch „Fascere“) haben bedingt durch die unregelmäßige Struktur der Form eine größere Oberfläche als Käse, die in einer gleichgroßen Form aus glattem Material hergestellt werden. Diese Formen eignen sich nicht für Weichkäse, da der Käse beim Wenden oft an der unregelmäßigen Oberfläche haften bleibt. Schnittkäse und Hartkäse lassen sich damit hervorragend herstellen.
Ich benutze Sizilianische Käsekörbe, sogenannte „Forma Formaggio Giunco“.
Es muss nicht das sizilianische Original sein, eigentlich eignet sich jeder halbwegs eng geflochtene Korb in der gewünschten Form für die Käsebereitung.
Schweizer Käseformen
In der Schweiz gibt es verschiedene Käseformen. Die „Järbe“, Formen mit fixer Höhe und die „Vätteren“, Formen mit fixem Durchmesser. Järbe wurden und werden heute noch auf den Almen benutzt, um dort Käse traditionell über dem offenen Feuer im Kupferkessi herzustellen und dann im Järb zu formen.
Damit der Käse seine typisch runde Form erhält, wird der in einem Käsetuch befindliche Käsebruch in das Järb, abgefüllt. Das Tuch dient dazu, dass die Käsebruchkörner kompakt in der Form bleiben. Sobald der Käsebruch vom Käser in das Järb gebracht wurde, wird der Käse gepresst und die überschüssige Molke entweicht.
Traditioneller Weise verwendeten die Schweizer Käsemeister Järb aus Holz. Steigende Anforderungen bezüglich den Hygienevorschriften haben dazu geführt, dass heutzutage grösstenteils Järbe aus Kunststoff eingesetzt werden. Die Aussenseite des Järb ist mit einer stabilen Schnur bestückt. Mit Hilfe dieser Schnalle und deren Positionierung kann die Schnur individuell gespannt werden.



Der Letzte Järbmacher, der Järbe traditionell mit der Hand aus Buchenholz herstellt ist Chrigel Schläpfer aus Hundwill im Appenzeller Hinterland. Chrigel fertigt Järbe in verschiedenen Durchmessern, von dem Järb für 2 kg Laibe bis hin zum Järb,für 10 kg Laibe. Ich verwende seine Järbe für die Herstellung meines Raclette-Käse.
Die Arbeit von Chrigel kann man hier bewundern: Link
Es gibt auch sehr schöne Keramikformen, die vom Design her archäologischen und historieschen Vorbildern entsprechen. Eine schöne Form habe ich von Henriette Kletschkus von Innenton erstanden. Mit einem praktischen Abtropfschälchen und Pressdeckel.