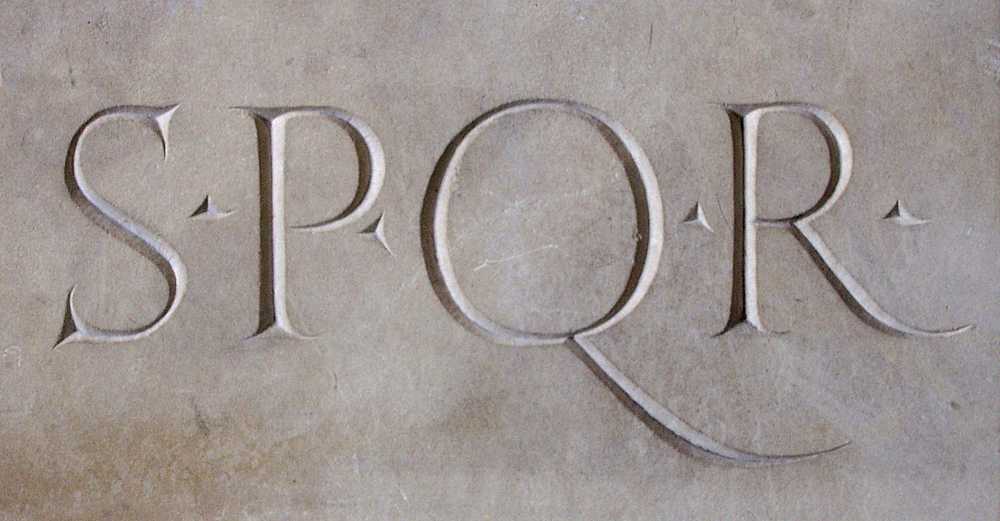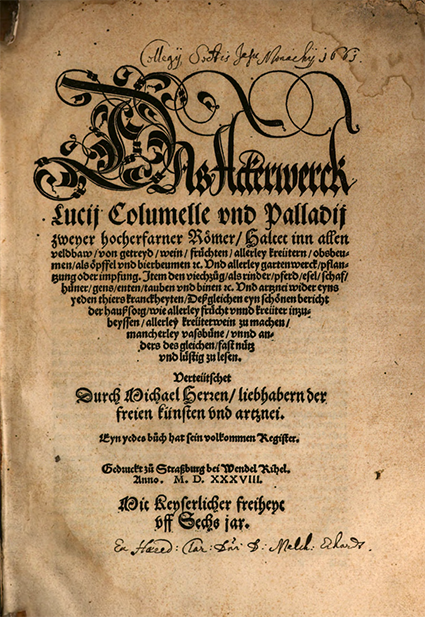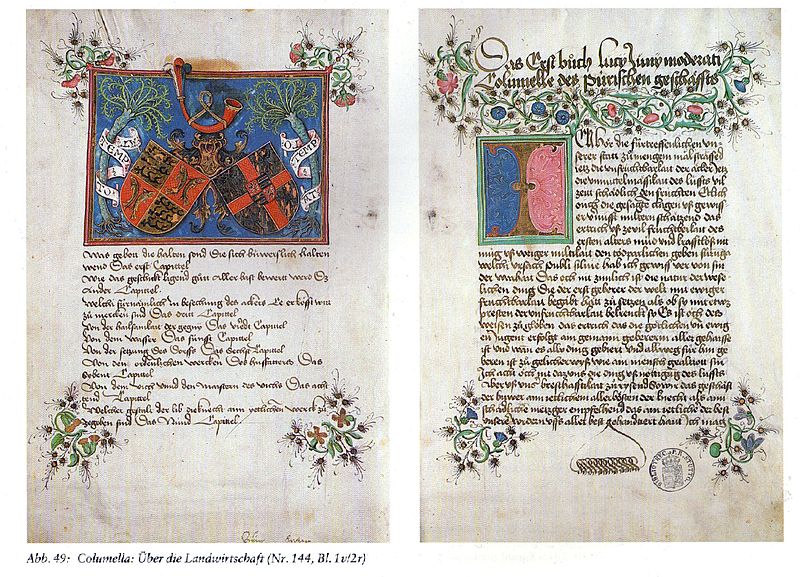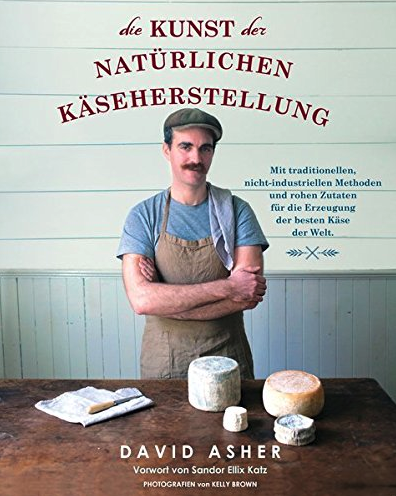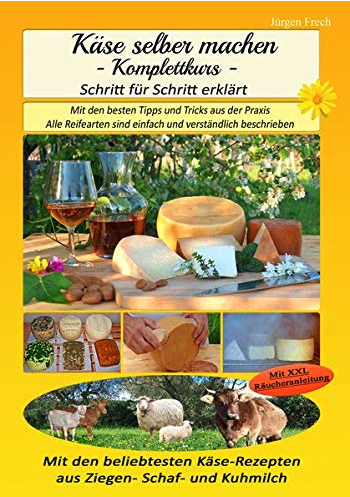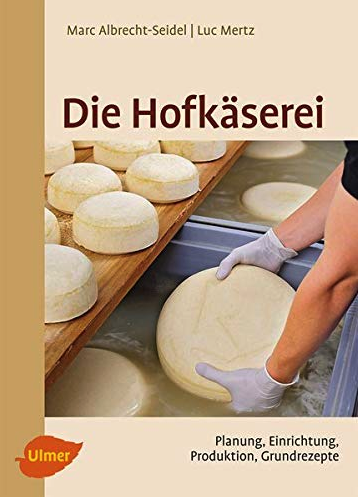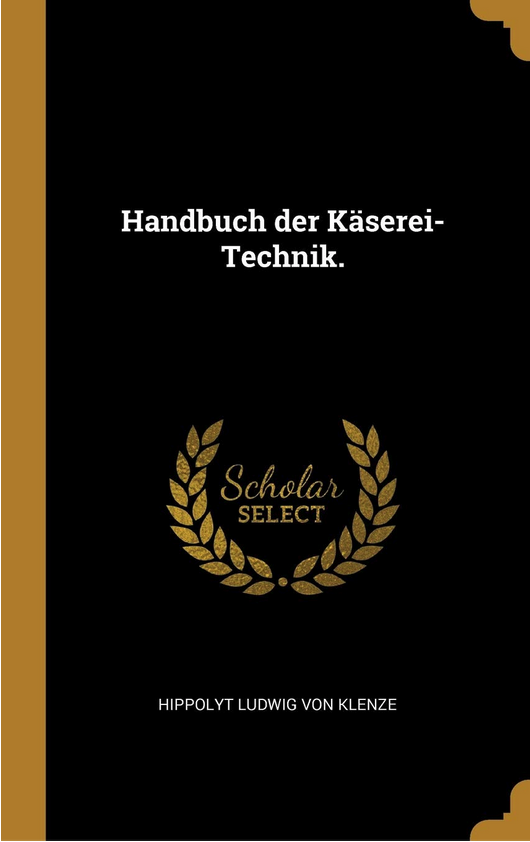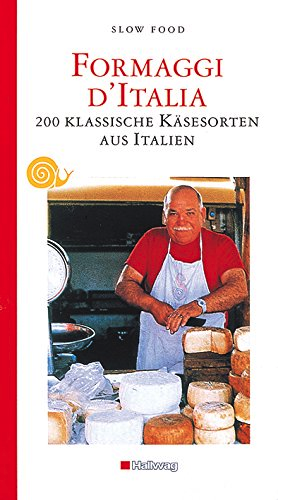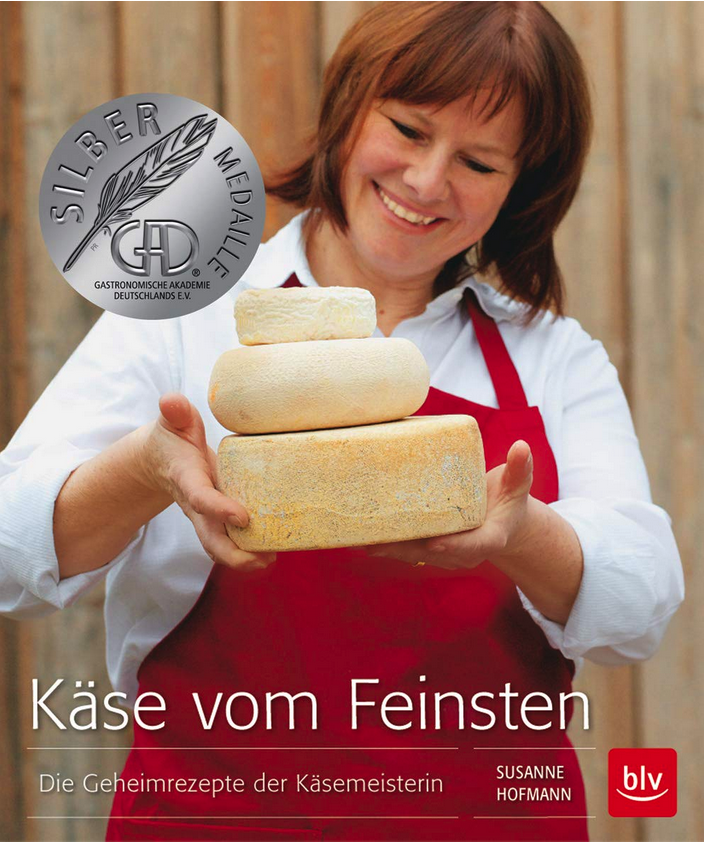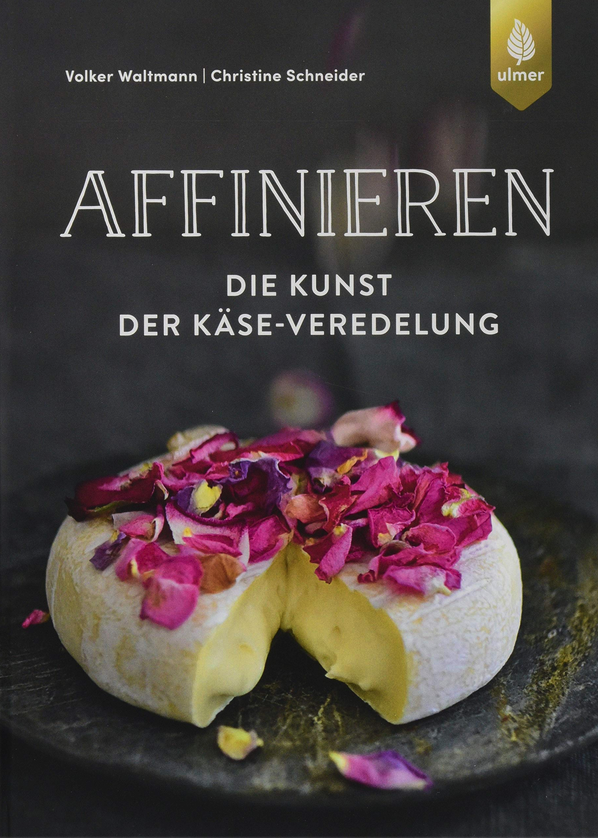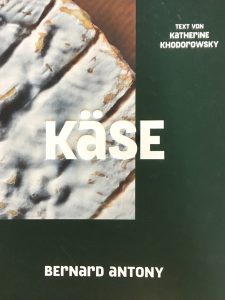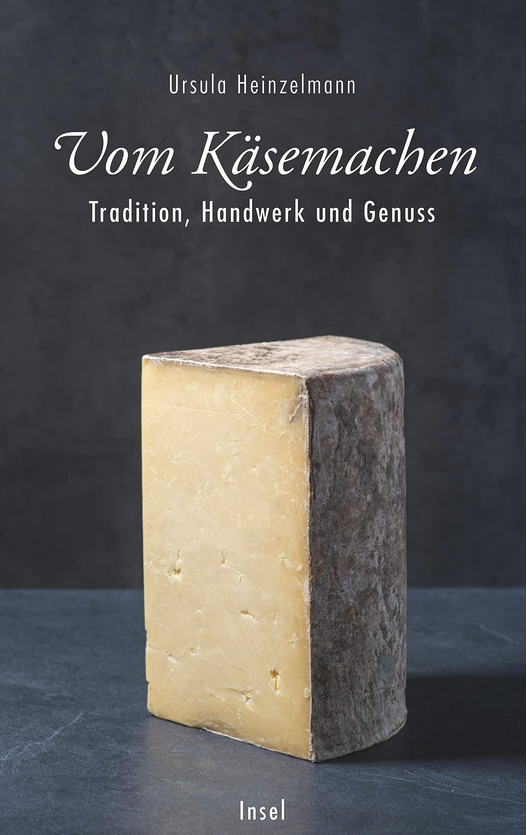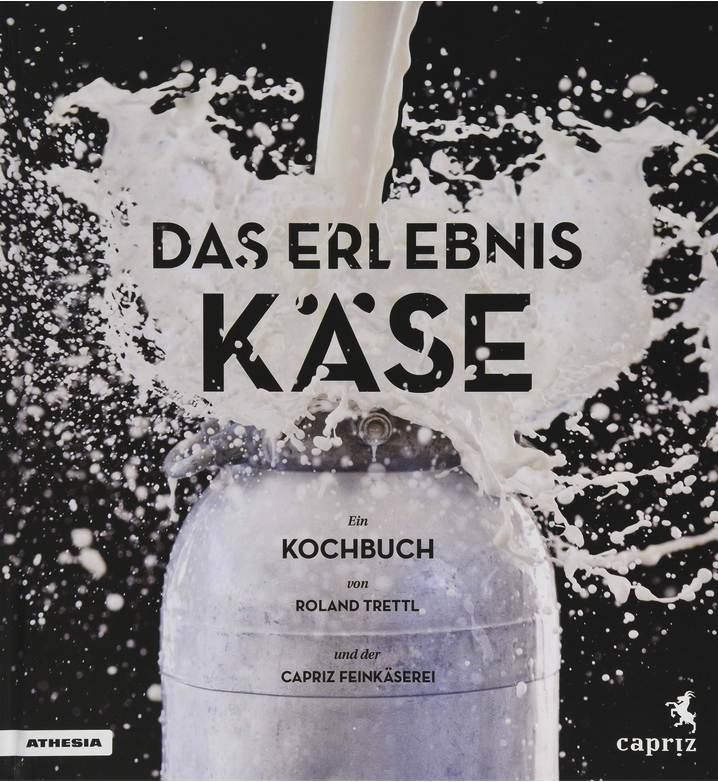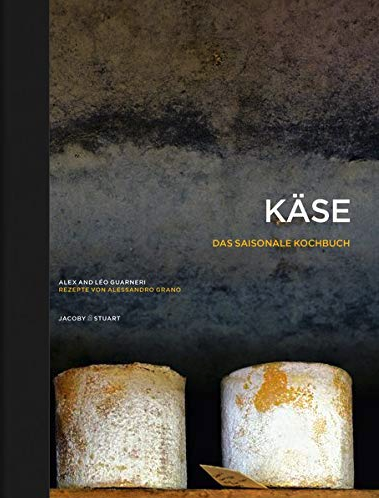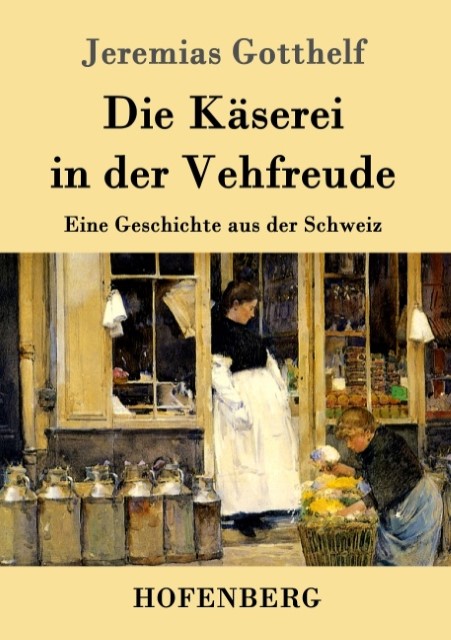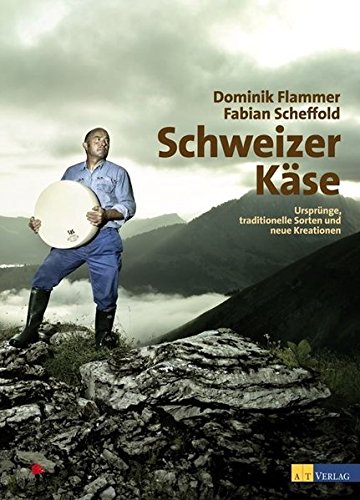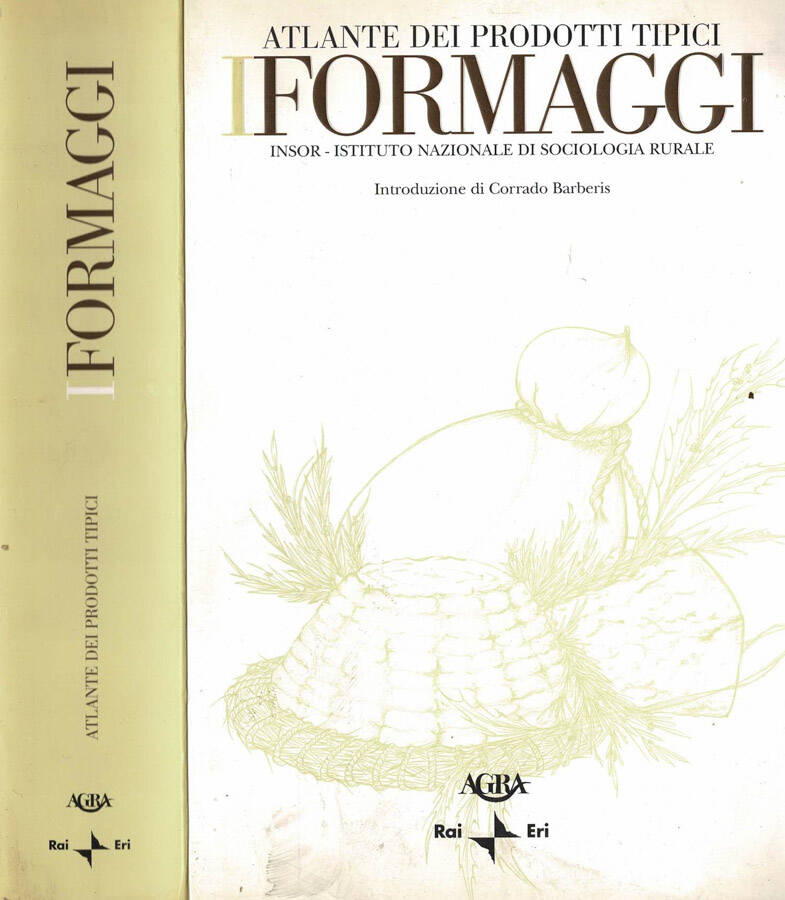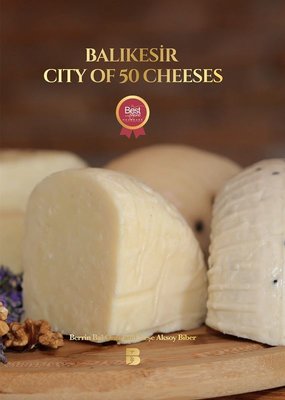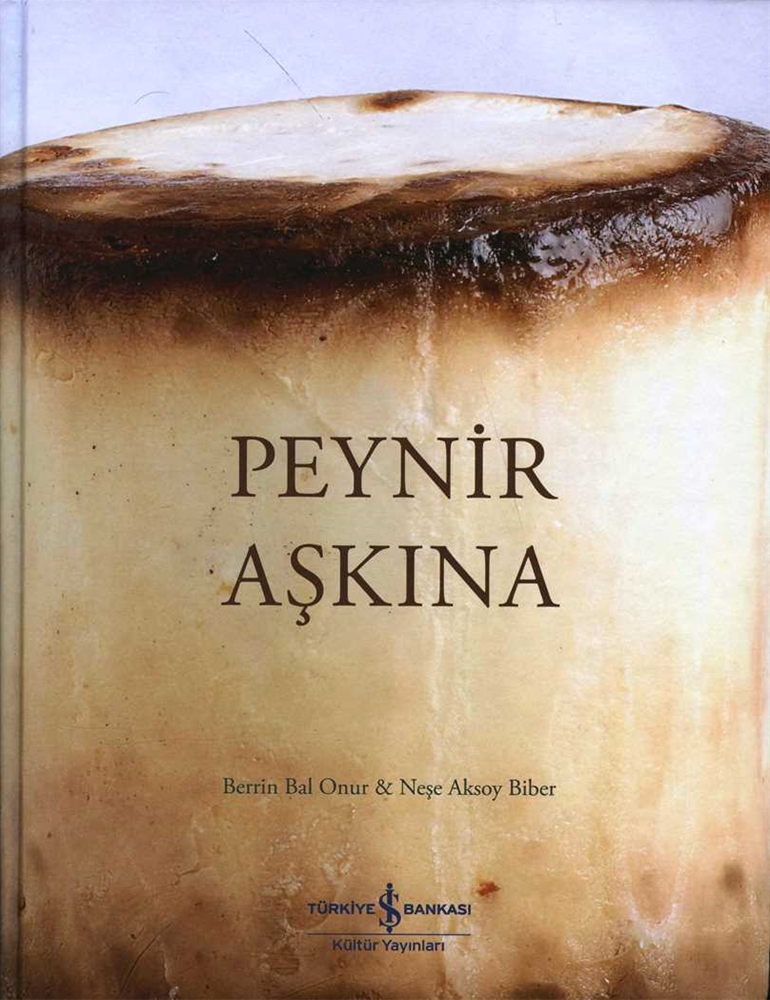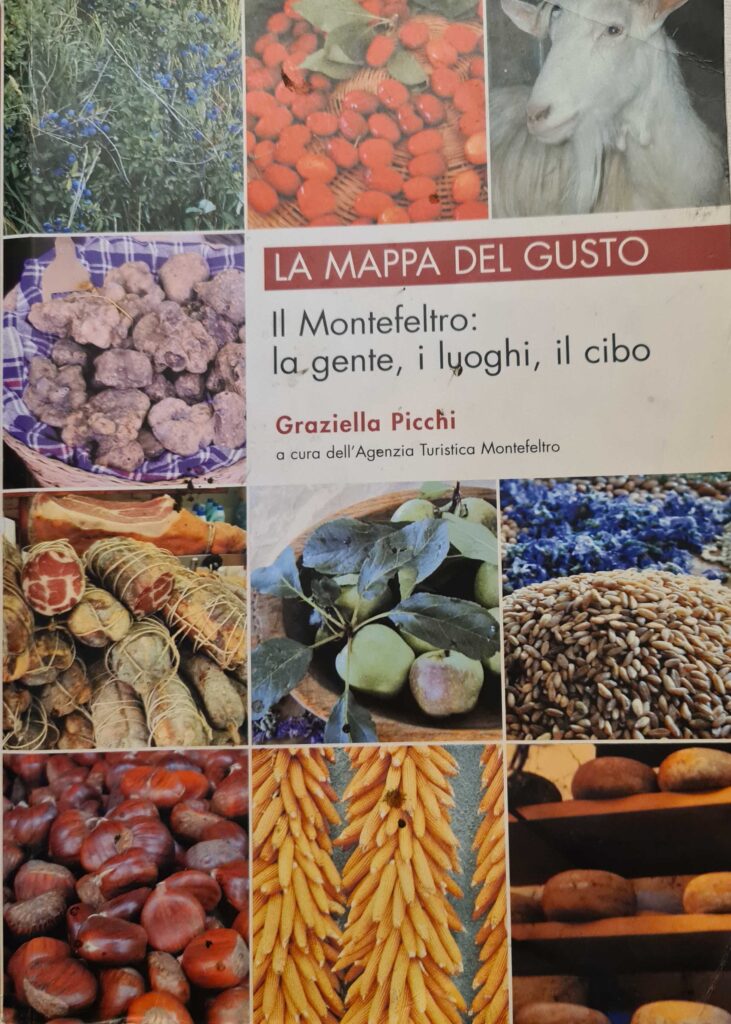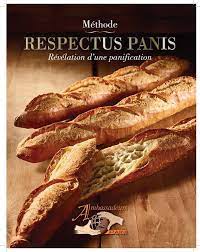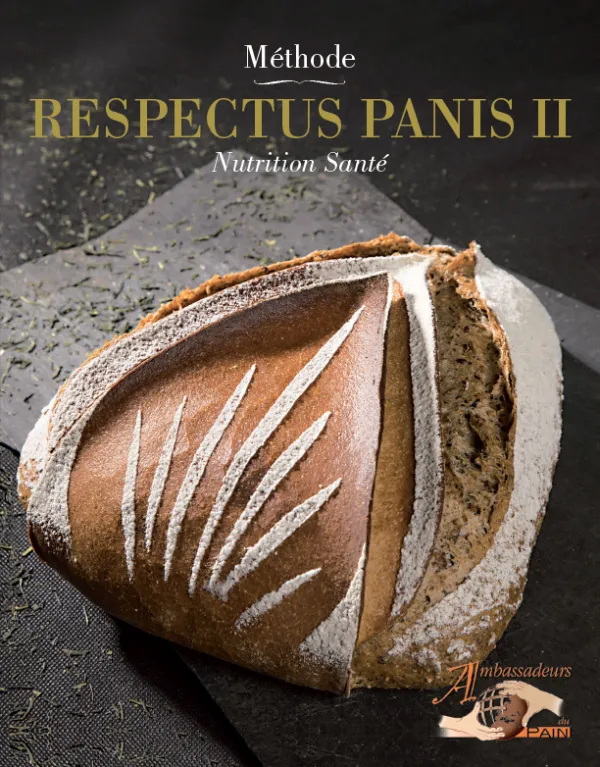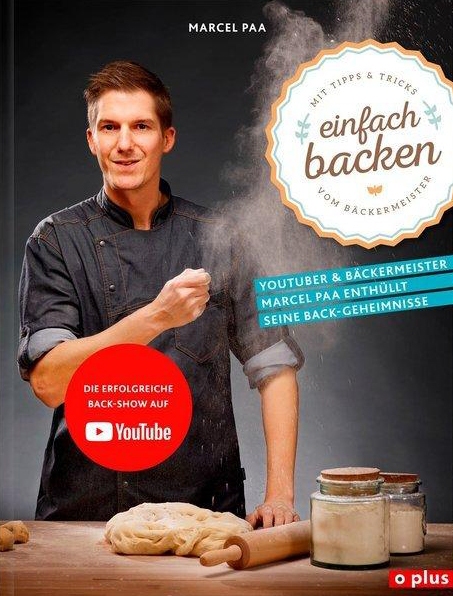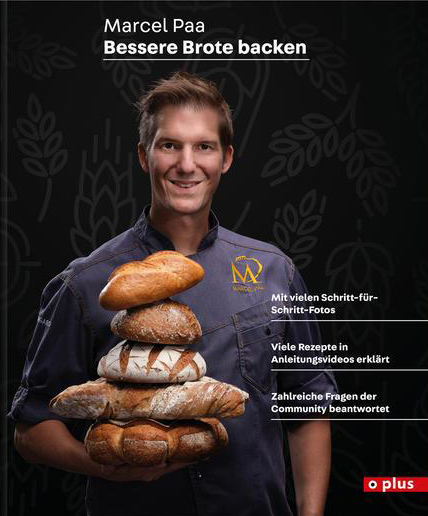Bestimmte Schritte bei der Käseherstellung bestimmen das Endprodukt.
Laktose ist eine Zuckerart, die in Milch vorkommt (daher nennt man sie auch Milchzucker) und ist der wichtigste Zucker in der Milch. Laktose bestehend aus den Einfachzuckern Dextrose und Galaktose. Die Aufspaltung der Laktose in die beiden Einfachzucker D-Galaktose und D-Glukose, ist der erste Schritt der Verdauung und erfolgt mit Hilfe des Enzyms Laktase.
Laktose ist immer in der Milch enthalten, egal ob Rohmilch oder pasteurisierte Milch, sie kommt so aus dem Euter der Kuh. Aber sie ist noch nicht aufgespalten in Galaktose und Glucose, daher die Unverträglichkeiten gegenüber der Laktose bei Menschen, denen das Enzym Laktase in der Darmflora fehlt.
Während der Fermentation bei der Käseherstellung wird die Laktose in Milchsäure umgewandelt. Wenn dies geschieht, beginnt die Trennung des Bruchs von der Molke. Dies geschieht in Rohmilch auf natürliche Weise. Pasteurisierte Milch enthält jedoch nicht die notwendigen Bakterien, um eine gleichmäßige Fermentation zu gewährleisten. Die meisten Käsereien verlassen sich deshalb auf Starterkulturen, um den Prozess zu starten und zu kontrollieren. Der größte Teil des Milchzuckers wird mit der Molke weggespült. Durch das Waschen des Käsebruchs wird ein Teil der Laktose entfernt, bevor sie sich in Milchsäure umwandelt. Dieser Schritt erfüllt zwei Ziele für den Käser: Der fertige Käse wird mit der Reifung süßer und der Käse wird laktosefrei. Die kleine Menge Laktose, die mit dem Käsebruch zurückbleibt, wird weiter abgebaut, wenn der Käse altert. Bei jungem Käse, der als laktosefrei deklariert ist, wurden der Milch Enzyme zugeführt, die die Laktose (den Milchzucker) zersetzen. Mittlerweile hat sich die Bezeichnung „laktosefrei“ für Produkte mit einem Laktosegehalt von ≤ 0,1 g/100 g bzw. 0,1 g/100 ml durchgesetzt. Diese Deklaration bedeutet also nicht „laktosefrei“ sondern eher sehr „laktosearm“.
Je nachdem, wie sensibel ein laktoseintoleranter ein Mensch reagiert, können auch geringe Mengen Laktose schon nicht vertragen werden und zu allergischen Reaktionen führen.
Schafskäse und Ziegenkäse sind leichter verdaulich als Käse aus Kuhmilch. Der Grund dafür ist die kleinkettigen Verbindung der Fett- und Buttersäuren in dieser Milch, was sie leichter verdaulich macht. Daher muss aber bei der Verarbeitung der Ziegen- oder Schafsmilch schnell, aber auch behutsam gearbeitet werden, denn diese Milch schneller reift und ist gegenüber mechanischer Behandlung sehr viel empfindlich ist als Kuhmilch. Der Laktosegehalt ist bei Ziegen- und Schafsmilch nahezu wie bei Kuhmilch und auch chemisch ähneln sie sich.
In dem sehr interessanten Buch „Unterschätzte Getreidearten: Einkorn, Emmer, Dinkel & Co.“ von Thomas Miedaner & Friedrich Longin, erschienen im Erling Verlag, 2022, ISBN: 978-3862631797, schreiben die Autoren auf den Seiten 100-101:
„Der moderne Mensch ist mit der Aufnahme von Milch und Milchprodukten erst recht kurz konfrontiert. Ursprünglich konnten nur Babys und Kleinkinder, die noch gesäugt werden, den Milchzucker (Laktose) mit einem speziellen Enzym, der Laktase, spalten und verwerten. Mit zunehmendem Alter schwächt sich die Laktasebildung normalerweise ab, Milch wird dann nicht mehr vertragen und führt zu Verdauungsproblemen. Der nordeuropäische Mensch hat vor ca. 7.500 Jahren zeitgleich mit der Domestikation von Rind, Schaf und Ziege die Fähigkeit entwickelt, Milchzucker auch im Erwachsenenalter zu verdauen. Der evolutionäre Vorteil liegt in der Sonnenarmut Nordeuropas begründet, die, vor allem im Herbst und Winter, die Haut zu wenig Vitamin D bilden lässt, das u. a. für den Knochenaufbau (Kalziumresorption) wichtig ist. Durch Milchzucker erfolgt eine ausreichende Kalziumversorgung auch ohne Sonne. Dies deckt sich mit der Beobachtung, dass in Skandinavien 98% der Menschen Laktose ihr ganzes Leben problemlos verdauen können, in Deutschland noch 80%, in Süditalien nur noch 30% und in Äquatornähe und manchen asiatischen Gesellschaften nur 2%. Laktoseunverträglichkeit ist also eigentlich keine Krankheit, sondern stellt für Menschen aus sonnenreichen Regionen die Normalität dar. Menschen, die Milchzucker noch als Erwachsene abbauen, sind also eine relativ junge genetische Variation.
Ähnlich sieht es mit Alkohol aus, wo Europäer eine wesentlich besser funktionierende Alkoholdehydrogenase entwickelten als einige Asiaten. Ursache war wahrscheinlich der starke Selektionsdruck in Europa zu Zeiten des Mittelalters, der Menschen mit ausgeprägten Toleranzen gegenüber Alkohol bevorzugte. Bei der damaligen Verkeimung des Wassers waren leicht alkoholische Getränke einfach lebensverlängernd. Im asiatischen Raum hingegen spielte der Alkohol zu dieser Zeit keine so dominante Rolle, hier trank man Tee aus abgekochtem Wasser. Der (Nord-)Europäer, und dies gilt natürlich auch für die meisten heutigen Amerikaner, Kanadier und Australier, hat es also in evolutionär kurzer Zeit geschafft, sich physiologisch an völlig neue Produkte der Landwirtschaft, wie Milch und Alkohol, anzupassen, warum sollte das nicht auch für Weizen geschehen sein, der schon seit Zehntausenden von Jahren in Europa und Südwest-Asien vom Menschen regelmäßig gegessen wird? Von der evolutionär noch viel kürzeren Anpassung an tropische Früchte oder gar technisch modifizierte Nahrung, wie fettreduzierte, zuckerreduzierte oder andere Produkte ganz zu schweigen.“
(Zitat mit freundlicher Genehmigung des ERLING Verlag GmbH & Co. KG, 29459 Clenze.)
Das so oft gehörte Argument, Milch sei schädlich für den Menschen, weil sie von der Natur für Kälber und nicht für Erwachsene Menschen „gedacht“ sei ist somit nicht haltbar. Vielmehr ist die Fähigkeit Milch und Milchprodukte zu verstoffwechseln ein evolutionärer Anpassungsprozess der dem Überleben diente und dient.
(Zitat mit freundlicher Genehmigung des ERLING Verlag GmbH & Co. KG, 29459 Clenze.)
A1 & A2 Milch
Kuhmilch weist in der Regel A1- oder A2-Milcheiweiße auf, die sich minimal im Aufbau unterscheiden.
Bei der A2-Milch soll es sich um eine unveränderte Variante der natürlichen Vollmilch (Urmilch) handeln. Im Laufe der Evolution ist bei Rindern eine Punktmutation aufgetreten, die sogenannte A1 Variante. A1-Milch ist das Ergebnis einer A1-Genmutation, die vor Hunderten von Jahren aus der Holsteiner Kuh gezüchtet wurde, während ältere Kuhrassen A2-Milch produzieren. Der Großteil der europäischen und amerikanischen Rinderrassen produziert demnach A1-Milch und Milch mit einer Mischung von A1- und A2-Kasein.
Kuhmilch enthält verschiedene Eiweiße, darunter auch das sogenannte Beta-Kasein. Beta-Kasein ist seinerseits aus 209 Aminosäuren zusammengesetzt. Der Unterschied zwischen A1- und A2-Milch liegt allein an der Position 67 dieser Aminosäurenkette. Bei A2 Beta-Kasein sitzt an Stelle 67 die Aminosäure Prolin, während die A1-Milch an dieser Stelle Histidin enthält. Dieser Unterschied soll A2-Milch jedoch verträglicher oder sogar gesünder machen. Jedoch fehlen bisher wissenschaftliche Beweise.
Als wissenschaftlich gesichert gilt:
- Der Unterschied in der Aminosäure bei A1 bzw. A2 Beta-Kasein bewirkt, dass das Kasein im Darm unterschiedlich abgebaut wird. Die Folge dieses Unterschieds: A1-Milch und A2-Milch verhalten sich bei der Verdauung unterschiedlich.
- Ein Zusammenhang mit Laktoseintoleranz ist zurzeit nicht ersichtlich. Sowohl A1- als auch A2-Milch enthalten Laktose. Eine Theorie lautet jedoch: Einige Menschen, die Milch nicht gut vertragen, glauben nun, dass sie laktoseintolerant sind. Vielleicht reagieren sie aber auf den Unterschied der A1- und A2-Milcheiweiße.
Es liegt ausschließlich an der Genetik der jeweiligen Kuh, ob sie Milch mit der Milcheiweißstruktur A1 Beta-Kasein oder A2 Beta-Kasein gibt. Die Zusammensetzung der Milch ist daher von der jeweiligen Rinderrasse abhängig. Kuhrassen wie Holstein, Friesian, Ayrshire und British Shorthorn produzieren hauptsächlich A1-Milch, während Kuhrassen wie Guernsey, Jersey, Charolais und Limousin hauptsächlich A2-Milch produzieren. Bei Braunvieh sind es über 70 % und bei Fleckvieh knapp 40 % mit der A2-Variante. Bei Holsteinkühen sind nur etwa 36 % der Tiere reinerbige A2-Träger. Auch indische Rinder und Rinder der Massai geben A2-Milch, ebenso Ziegen, Schafe, Yaks und Büffel.
Fazit
A1-Milch enthält A1-Beta-Casein, das während der Verdauung BCM-7 produziert; BCM-7 verursacht verschiedene gesundheitliche Auswirkungen, darunter Verdauungsprobleme, Typ-1-Diabetes bei Kindern, SCID und Herzkrankheiten. Auf der anderen Seite enthält A2-Milch nur Beta-Casein A2, das während der Verdauung kein BCM-7 produziert. Daher verursacht es keine leichten bis schwere gesundheitliche Auswirkungen. Der Hauptunterschied zwischen A1- und A2-Milch ist die Art des in der Milch vorhandenen Beta-Caseins und die gesundheitlichen Auswirkungen.
Somit bestimmt schon die Rinderrasse die Verträglichkeit der späteren Endprodukte. Gefolgt vom Futter der Tiere und der weiteren Verarbeitung der Milch. Bei einigen geschützten Käsearten ist genau festgelegt, von welchen Rinderrassen die Milch stammen darf. Auch hier mag der Grund u.a. in den Unterschieden zwischen A1- / A2-Milch liegen. Der Ausgangstoff bestimmt die Qualität des Endprodukts.
In den Proteinen (Eiweiß) der A1 Milch liegt wahrscheinlich auch der Grund, warum manche Menschen die glauben eine Laktoseunverträglichkeit zu haben, diese Milch ohne Probleme vertragen.
Einige Menschen, die glauben, dass sie laktoseintolerant sind, sind in Wirklichkeit offenbar allergisch gegen Milch. Oft vertragen Menschen, die allergisch auf Kuhmilch reagieren Ziegen- oder Schafsmilch ohne Probleme. Der Begriff Laktoseintoleranz hat jedoch so viel Popularität erlangt, dass viele die beiden Zustände verwechseln.
In meiner Käsereipraxis hat sich gezeigt, das Distellab bei der Dicklegung und im späteren Reifeprozess des Käses, sich ebenfalls positiv auf die Verträglichkeit von Käse für laktoseintolerante oder histaminintolerante Menschen auswirkt. Dies wird auch von einigen mit Distellab arbeitenden italienischen Käsereien so vermarktet.
Im Bereich „Crème fraîche aus Kefir oder Joghurt“ finden sich Anleitungen zur Herstellung laktosefreier Milchprodukte.